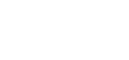Begrünung von Dachflächen
Vom urbanen Grüntraum zur nachhaltigen Zukunft
 Viele Bauherren entscheiden sich heute für Gründächer, denn sie haben viele Vorteile. In Deutschland gibt es schon ca. 12 Millionen m² begrünte Dachfläche. Vor allem in den dicht bebauten Städten sind Gartenflächen rar und in der Regel auch relativ teuer. Durch ein begrüntes Dach kann man sich die blühende Natur in die unmittelbare Nähe holen.
Viele Bauherren entscheiden sich heute für Gründächer, denn sie haben viele Vorteile. In Deutschland gibt es schon ca. 12 Millionen m² begrünte Dachfläche. Vor allem in den dicht bebauten Städten sind Gartenflächen rar und in der Regel auch relativ teuer. Durch ein begrüntes Dach kann man sich die blühende Natur in die unmittelbare Nähe holen.
Die Begrünung von Dachflächen verbindet Tradition handwerklicher Dachdeckertechniken mit der Technik moderner Umwelt- und Energiekonzepte. Ob extensiv oder intensiv, Flachdach oder Flanke: Gründächer leisten einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz, verbessern das Stadtbild und schaffen Lebensqualität. Mit sorgfältiger Planung, fachgerechter Ausführung und regelmäßiger Pflege wird jedes Dach zu einem kleinen Biotop, das Mensch und Natur gleichermaßen bereichert. Angesichts wachsender urbaner Herausforderungen sind begrünte Dächer nicht länger Luxus, sondern eine zukunftsweisende Standardlösung im nachhaltigen Bauen.
Extensiv- und Intensivbegrünung
Im Bereich der Dachbegrünung wird zwischen Extensiv- und Intensivbegrünung unterschieden.
Bei der extensiven Dachbegrünung werden trockenresistente Pflanzenarten verwendet, diese werden dann ausschließlich im ersten Jahr nach dem Pflanzen bewässert. Nach dieser Zeit sind die Pflanzen gut angewachsen und kommen mit dem Regenwasser aus.
Bei der Intensivbegrünung mit Rasen, vielen Stauden und Sträuchern ist auch die Bewässerung nötig. Es gibt hierfür auch automatische Bewässerungssysteme.
Dachneigung
Die Dachneigung sollte zwischen 2 und 10° liegen. Bei einem Dach mit einer Neigung über 10° werden dann Vorkehrungen gegen die auftretenden Schub- und Erosionskräfte nötig. Liegt die Dachneigung über 35°, ist eine Begrünung aus bautechnischen Gründen in der Regel nicht möglich.
Vorteile:
- Die Dachabdichtung wird durch die Begrünung (vor UV-Strahlen) geschützt
- Ein Gründach schafft zusätzlichen Lebensraum (Gartenfläche)
- senkt den Heizbedarf im Winter
- Durch die Verdunstung des auf dem Dach gespeicherten Regenwassers verbessert sich das Raumklima, der darunter liegenden Räume.
- Ein Gründach bietet Tieren, wie Bienen und Schmetterlingen, einen Lebensraum.
- Wird von vielen Menschen als attraktiv empfunden
Nachteile:
- die Anschaffungskosten sind relativ hoch
- die Pflanzen und Sträucher müssen regelmäßig gepflegt und geschnitten werden
Ist es erlaubt?
In der Regel ist das Begrünen von Dächern ohne eine spezielle Genehmigung möglich.
In manchen Regionen gibt es jedoch Bebauungspläne, die bestimmte Bebauungen vorschreiben.
Informieren Sie sich am besten bei Ihrer Gemeinde.
Die Begrünung von Dachflächen verbindet Tradition handwerklicher Dachdeckertechniken mit Technik moderner Umwelt- und Energiekonzepte. Ob extensiv oder intensiv, Flachdach oder Flanke: Gründächer leisten einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz, verbessern das Stadtbild und schaffen Lebensqualität. Mit sorgfältiger Planung, fachgerechter Ausführung und regelmäßiger Pflege wird jedes Dach zu einem kleinen Biotop, das Mensch und Natur gleichermaßen bereichert. Angesichts wachsender urbaner Herausforderungen sind begrünte Dächer nicht länger Luxus, sondern eine zukunftsweisende Standardlösung im nachhaltigen Bauen.
Immer häufiger setzen Bauherren und Städteplaner auf die Begrünung von Dachflächen, um urbane Räume ökologisch aufzuwerten und das Mikroklima zu verbessern. Rund zwölf Millionen Quadratmeter begrünter Dächer gibt es bereits in Deutschland – eine beeindruckende Zahl, wenn man bedenkt, wie rar und kostbar Gartenflächen in dicht bebauten Ballungsräumen geworden sind. Ein Gründach holt die Natur direkt ins Blickfeld und trägt gleichzeitig dazu bei, Regenwasser zu managen, Energie zu sparen und die Artenvielfalt zu fördern.
Gründächer im Überblick
Ein Blick über die Dächer zeigt zwei grundlegend verschiedene Arten der Begrünung: die Extensivbegrünung, die durch pflegeleichte, trockenresistente Pflanzen besticht, und die Intensivbegrünung, die mit Rasenflächen, Stauden und Sträuchern eher an einen Dachgarten erinnert. Extensivsysteme kommen mit einem flachen Substrat aus und benötigen nach der Erstbewässerung kaum zusätzliche Pflege – plump ausgedrückt wässert der gelegentliche Regen den Dachgarten. Intensivsysteme hingegen gleichen kleinen Parks auf dem Dach: Sie verlangen regelmäßig Wasser, Pflege und manchmal sogar einen Gehweg, um bequem das Grün genießen zu können.
Die Entscheidung zwischen Extensiv- und Intensivbegrünung hängt von den Zielen, dem Budget und den baulichen Gegebenheiten ab. Möchte man lediglich eine natürliche Dämmung und einen Beitrag zum Regenwasserrückhalt erzielen, genügt oft eine Extensivbegrünung. Soll das Dach jedoch als begehbare Grünfläche dienen oder gar als Gemeinschaftsgarten angelegt werden, führt an einer intensiven Lösung kaum ein Weg vorbei.
Technische Grundlagen und Dachneigung
Die technische Umsetzung eines Gründachs beginnt schon bei der Neigung des Daches. Flachdächer mit einer Neigung von bis zu zehn Grad sind ideal geeignet, da sie die Haftung des Substrats gewährleisten und kaum zusätzliche Sicherungsmaßnahmen gegen Abrutschung erfordern. Bei Dachneigungen zwischen zehn und 35 Grad kommen Erosionsschutzmatten oder Verankerungssysteme zum Einsatz, um die Vegetationsschicht zu stabilisieren. Dächer steiler als 35 Grad werden aus statischen und sicherheitsrelevanten Gründen meist nicht begrünt.
Unter der Vegetationsschicht liegen mehrere Schichten, die gemeinsam funktionieren: eine wasserdichte Abdichtung, eine Wurzelschutzfolie, eine Drainschicht für überschüssiges Regenwasser, eine Filterschicht, die das Substrat zurückhält, sowie schließlich das eigentliche Gründachsubstrat. Auf diesen technischen Aufbau folgt das Pflanzenleben – Sedumarten bei Extensivsystemen oder eine bunte Mischung aus Gräsern, Kräutern und Stauden bei intensiven Systemen.
Wer sich für die detaillierten technischen Regelwerke interessiert, findet auf der Website der Fachvereinigung Bauwerksbegrünung e. V. umfassende Informationen zu Planung, Ausführung und Pflege. Einen allgemeinverständlichen Einstieg bietet die Wikipedia-Seite zur Dachbegrünung.
Planung und Umsetzung
Die erfolgreiche Umsetzung eines Gründachs beginnt in der Planungsphase. Zunächst klärt der Fachplaner die statischen Voraussetzungen: Kann das bestehende Dachtragwerk die Zusatzlast von Substrat, Wasser und Pflanzen tragen? Eine Prüfung der Bausubstanz und eine statische Nachrechnung sind unerlässlich, um spätere Schäden oder gar Gefährdungen zu vermeiden.
Anschließend erfolgt die Auswahl des geeigneten Begrünungssystems. Extensivdächer überzeugen durch ihre Kosteneffizienz und den geringen Pflegeaufwand. Sie werden bereits im ersten Jahr nach der Pflanzung bewässert, um das Anwachsen sicherzustellen. Intensivdächer dagegen benötigen ein komplexeres Bewässerungsnetz – oft kommen automatische Systeme zum Einsatz, die auf Feuchtesensoren basieren und den Wasserbedarf präzise regulieren.
Bei der Ausschreibung arbeiten Bauherr, Architekt und Fachbetrieb eng zusammen. Ein klar definiertes Leistungsverzeichnis, orientiert an den Richtlinien des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) und der Fachvereinigung, sorgt dafür, dass alle Beteiligten von Anfang an die gleichen Qualitätsstandards verfolgen. Die Abnahme erfolgt in mehreren Schritten: Abdichtungsprüfung durch Wasserprobe, Kontrolle der Substratschichtstärken sowie Inspektion der Vegetationsdichte.
Wirtschaftlichkeit und Fördermöglichkeiten
Ein Gründach schlägt zunächst höher zu Buche als eine konventionelle Dachfläche. Die Anschaffungskosten variieren je nach Begrünungsart zwischen 30 und 300 € pro Quadratmeter. Doch rechnet man die Wirtschaftlichkeit über den Lebenszyklus, zeigt sich schnell das langfristige Einsparpotenzial: Die Dämmwirkung lässt Heizkosten im Winter um bis zu zehn Prozent sinken, im Sommer schützen die Pflanzen vor Überhitzung und reduzieren den Energiebedarf für Klimatisierung.
Hinzu kommt die mögliche Entlastung der kommunalen Regenentwässerungssysteme, die sich in vielen Städten in höhere Nebenkosten für Regenwassergebühren übersetzen kann. Manche Städte offerieren auch finanzielle Anreize oder Zuschüsse für Dachbegrünungen: Kommunen wie Hamburg, Freiburg und Berlin fördern Gründächer mit bis zu 50 % der Investitionskosten. Eine Übersicht über nationale Förderprogramme liefert das Umweltbundesamt auf seiner Website unter der Rubrik „Stadtgrün und Klimaschutz“.
Pflege und Wartung
Die Pflege eines Gründachs hängt von der gewählten Begrünungsart ab. Extensivbegrünungen verlangen im Durchschnitt nur eine jährliche Inspektion, bei der Unkraut entfernte und die Vegetation begutachtet wird. Intensive Begrünungen benötigen eine regelmäßige Rasenpflege, Gehölzschnitt und Düngung. Ein detaillierter Pflegeplan, der spätestens bei der Bauabnahme erstellt wird, legt Intervalle und Maßnahmen fest. Profi-Betriebe für Garten- und Landschaftsbau übernehmen diese Wartung, doch erfahrene Hausbesitzer können kleinere Pflegearbeiten in Eigenregie durchführen.
Wer mehr über nachhaltige Gründachpflege und -bewirtschaftung erfahren möchte, findet auf der Seite des Deutschen Dachgärtner-Verbandes e. V. Praxis-Tipps und weiterführende Leitfäden.
Rechtliche Rahmenbedingungen
Grundsätzlich ist die Dachbegrünung in Deutschland baugenehmigungsfrei, sofern das Dach im Rahmen der zulässigen Nutzung bleibt und keine Denkmalauflagen verletzt werden. Ausnahmen können in besonderen Bebauungsplänen auftreten, wenn Städte einheitliche Fassaden- oder Dachgestaltungen vorschreiben. Vor Beginn der Arbeiten empfiehlt es sich daher, ein Gespräch mit dem zuständigen Bauamt zu führen.
Die einschlägigen Normen und Richtlinien finden sich in den Landesbauordnungen sowie in den technischen Regelwerken der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V. (FLL). Dort sind alle Anforderungen an Statik, Abdichtung und Pflege verbindlich definiert.
Best Practices und Fallbeispiele
In vielen deutschen Städten zeigen Leuchtturmprojekte, wie Gründächer wirkungsvoll eingesetzt werden können: Ein Innovationszentrum in München kombinierte auf seinem Flachdach eine extensive Begrünung mit Photovoltaik-Modulen; im Berliner Osten verwandelte ein Wohnblock sein Flachdach in eine hügelige Landschaft mit Sitzbereichen und Naschgarten. Schulen laden ihre Schüler ein, im Rahmen von Projekttagen ein Gründach anzulegen und so Wissen über Pflanzen, Wasserkreislauf und Klimaschutz hautnah zu erleben.
Kommunale Initiativen wie das „Grüne Netzwerk Ruhr“ dokumentieren auf regionalen Portalen zahlreiche Projekte und regen Bürger zur Nachahmung an. Diese Fallstudien machen Mut, Gründächer als Standardmaßnahme in der Stadtplanung zu verankern.
Unverzichtbarer Baustein nachhaltiger Stadtentwicklung
Die Begrünung von Dachflächen ist weit mehr als ein ästhetisches Extra: Sie ist ein unverzichtbarer Baustein nachhaltiger Stadtentwicklung. Von der Extensiv- bis zur Intensivbegrünung bieten Gründächer Lösungen für Energieeffizienz, Regenwassermanagement, Biodiversität und Lebensqualität. Dank moderner Planungstools, hochwertiger Materialien und digitaler Monitoring-Systeme verschmelzen klassische Dachdeckertechniken mit zeitgemäßen Technologien. Gemeinsam mit klar definierten Pflegekonzepten und rechtlichen Rahmenbedingungen entsteht so ein lebendiges Ökosystem auf unseren Dächern, das nicht nur Gebäude schützt, sondern ganze Stadtquartiere grüner, kühler und lebenswerter macht.
Weiterführende Informationen finden Sie auf der Wikipedia-Seite zur Dachbegrünung, beim Umweltbundesamt und in den Publikationen der Fachvereinigung Bauwerksbegrünung e. V..
Das Video „Wie funktioniert effiziente Flachdach-Dämmung“, des Chemiekonzerns BASF, zeigt den klassischen Aufbau eines gedämmten Flachdachs. Möglichkeiten und Vorteile der Wärmdämmung mit Dämmstoffen werden ebenfalls thematisiert. Gleiches gilt für die Dachbegrünung mit entsprechenden Pflanzen.
In dem Film wird des weiteren vorgeführt, wie das Flachdach eines modernen, zertifiziert nachhaltigen Gebäudes in Ludwigshafen gedämmt wird.