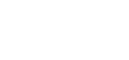Dachtraufe – Traufe
 Als Dachtraufe (oder kurz Traufe) bezeichnet man die längsseitige Tropfkante am Dach eines Gebäudes. Unterhalb der Dachtraufe wird vielfach die Dachrinne montiert, um abfließendes Regenwasser abzuleiten. Den Schnittpunkt zwischen Traufe und Außenwand bezeichnet man als Traufpunkt.
Als Dachtraufe (oder kurz Traufe) bezeichnet man die längsseitige Tropfkante am Dach eines Gebäudes. Unterhalb der Dachtraufe wird vielfach die Dachrinne montiert, um abfließendes Regenwasser abzuleiten. Den Schnittpunkt zwischen Traufe und Außenwand bezeichnet man als Traufpunkt.
Den Abstand zum Boden nennt man Traufhöhe. Das Traufrecht beschreibt das Recht, Regenwasser auf das Grundstück des Nachbarn in Tropfen fallen zu lassen. Die Traufe ist die untere Begrenzung einer geneigten Dachfläche. Oben befindet sich der Dachfirst, seitlich Ortgang, Grat und Kehle.
Unterhalb der Dachtraufe wird in den meisten Fällen eine Regenrinne montiert, die das abtropfende Wasser zu einem Fallrohr führt, durch das es in die Kanalisation, in eine Regentonne oder auch einfach auf den Boden geleitet wird.
Die Dachtraufe: Funktion, Konstruktion und rechtliche Aspekte
Die Dachtraufe ist ein zentrales Element jeder geneigten Dachkonstruktion. Sie bildet die untere Kante der Dachfläche und nimmt als Tropfkante das herabfließende Regenwasser auf, das über Regenrinnen und Fallrohre abgeleitet wird. In diesem umfassenden Artikel beleuchten wir die architektonische Bedeutung, den technischen Aufbau, die rechtlichen Rahmenbedingungen und die besten Praxislösungen rund um die Dachtraufe.
1. Definition und Begriffsabgrenzung
Die Dachtraufe ist die untere, längsseitige Tropfkante einer geneigten Dachfläche. Dort sammelt sich das von der Dachhaut ablaufende Regenwasser, wird über Traufbleche und angebrachte Dachrinnen aufgefangen und kontrolliert weitergeleitet. Sie ist nicht nur ein ästhetisches, sondern vor allem ein technisches und rechtliches Element:
-
Traufe (Dachtraufe): Die gesamte seitliche Kante, an der das Regenwasser abläuft. Ihre Form und Ausführung bestimmen, ob Nässe an die Fassade spritzt oder sauber in die Rinne geleitet wird.
-
Traufpunkt: Der Punkt, an dem die Dachlinie in die Wand übergeht—entscheidend für die Detaillösung der Abdichtung und den fachgerechten Anschluss der Rinne.
-
Traufhöhe: Der senkrechte Abstand zwischen dieser Tropfkante und dem Geländeniveau beziehungsweise dem Boden. Hier spielen Aspekte wie Bodenfreiheit und Zugang für Reinigungs- und Montagearbeiten eine Rolle.
-
Traufrecht: Ein Teil des Nachbarrechts. Es erlaubt die unkontrollierte Tropfenfall-Entwässerung auf das Nachbargrundstück, solange keine Schäden entstehen und keine Leitungen über die Grenze verlaufen.
Oberhalb der Traufe findet man den Dachfirst, die obere Kante, und seitlich die Ort- und Gratkanten, die in Kehlen oder Firstbereiche münden. Gemeinsam bilden diese Dachränder das profilsichere Entwässerungskonzept eines geneigten Daches.
2. Technischer Aufbau und Materialien
 Hinter der unscheinbaren Tropfkante verbirgt sich ein komplexer Aufbau, der in mehreren Schichten die Entwässerung, den Wärmeschutz und die Witterungsbeständigkeit sicherstellt:
Hinter der unscheinbaren Tropfkante verbirgt sich ein komplexer Aufbau, der in mehreren Schichten die Entwässerung, den Wärmeschutz und die Witterungsbeständigkeit sicherstellt:
-
Dacheindeckung:
Ob Tonziegel, Schiefer, Blech oder Bitumenbahnen – das Obermaterial leitet das Wasser direkt zur Traufe. -
Unterdach bzw. Unterspannbahn:
Eine diffusionsoffene Bahn verhindert Winddruckeintrag und leitet hinter die Eindeckung gelangte Feuchtigkeit kontrolliert ab. -
Konterlattung und Lattung:
Sichern die Hinterlüftung und Befestigung der Dacheindeckung. Gerade an der Traufe ist auf korrekte Gefälle- und Lattungsabstände zu achten. -
Sparren:
Tragen Dachlasten und bilden zusammen mit Mauerlatten die statische Basis. -
Traufblech (Ortblech):
Ein profiliertes Metallblech (Kupfer, verzinktes Stahlblech oder Aluminium) deckt die erste Reihe der Dacheindeckung ab und führt das Wasser sauber in die Rinne. -
Dachrinne:
Sammelrinne, klassisch aus Stahl, Kunststoff oder Kupfer, dimensioniert nach regionalen Niederschlagsdaten (DIN 1986). Rinnenhalter und Gefälle von mind. 2 % sorgen für den kontinuierlichen Wasserstrom. -
Fallrohr:
Leitet das Regenwasser senkrecht ab, wahlweise in die Kanalisation, Zisterne oder auf Spritzschutzbögen am Boden. Fallrohre mit Revisionsstutzen erleichtern die Wartung. -
Fassadenanschluss (Traufabschlussprofil):
Zwischen Rinne und Fassade sorgt ein Abschlussprofil für Spritzwasserschutz und Luftzirkulation bei hinterlüfteten Wänden. Spezielle Putzanschlussleisten verhindern Feuchte auf der Putzoberfläche. -
Dichtstoffe und Verbindungsstücke:
Muffen an den Rinnensegmenten, Silikon- oder EPDM-Dichtungen an Anschlussstellen müssen UV‑ und frostbeständig sein. -
Speziallösungen für Flachdächer:
Hier erfolgt die Entwässerung oft über abgedichtete Attika-Rinnen oder innenliegende Drainagen, die hinter der Attika verborgen sind. - Traufwinkel: Spezielle Blechform zur Führung des Wassers an verwinkelten Traufabschnitten.
Durch die passgenaue Kombination dieser Elemente gewährleistet die Dachtraufe eine langlebige, wartungsfreundliche und rechtskonforme Entwässerung. Die Auswahl des Materials (Kupferblech, verzinktes Stahlblech, Aluminium) richtet sich nach Bauumgebung, Lebensdaueranforderungen und Wartungsintervallen.
3. Planungsgrundlagen und Bauvorschriften
3.1 Normen und technische Regelwerke
- DIN 18531 – Abdichtung von Dächern: Regelt Anforderungen an Abdichtungsbahnen und Anschlussdetails.
- DIN 1986 – Entwässerungsanlagen: Legt Mindestdimensionen für Dachrinnen und Fallrohre fest.
- DIN EN 12056 – Schwerkraftentwässerung: Europäischer Standard für normgerechte Regenwasserableitung.
3.2 Traufhöhe und Ortgesetz
In vielen Landesbauordnungen ist vorgeschrieben, dass Traufhöhen einen gewissen Abstand zu Fenstern und Wegen einhalten, um Spritzwasser zu vermeiden. Die Traufhöhe beeinflusst ferner die Bemessung von Rinnenquerschnitten und Fallrohren.
3.3 Nachbarrecht und Traufrecht
Das Traufrecht erlaubt es, Regenwasser in Tropfenform auf das Nachbargrundstück abzugeben, ohne dessen Zustimmung einholen zu müssen. Anders verhält es sich mit leitungsgebundenem Abfluss: Hier ist oft ein Abwasser- bzw. Regenwasserrecht einzuräumen.
Weitere Informationen zum Nachbarrecht bietet das Bayerische Staatsministerium der Justiz sowie bundesweit die Publikationen des Bundesministeriums der Justiz (BMJ).
4. Planung und Ausführung der Traufe
4.1 Maßliche Festlegung
 Die Traufe wird in der Werkplanung mit exakten Höhenangaben definiert. Dabei sind Dachneigung, Attikahöhe und Wandanschlüsse zu berücksichtigen. Ein HLS-Planer (Heizung/Lüftung/Sanitär) dimensioniert Dachrinnen und Fallrohre anhand der regionalen Niederschlagskennwerte.
Die Traufe wird in der Werkplanung mit exakten Höhenangaben definiert. Dabei sind Dachneigung, Attikahöhe und Wandanschlüsse zu berücksichtigen. Ein HLS-Planer (Heizung/Lüftung/Sanitär) dimensioniert Dachrinnen und Fallrohre anhand der regionalen Niederschlagskennwerte.
4.2 Montage der Dachrinne
- Rinnenhalter: Im Abstand von 50–80 cm an der Traufe montiert.
- Rinne einsetzen und verbinden: Muffen-, Dreh- oder Kastenrinnen sorgen für dichte Verbindungen.
- Gefällesicherung: Mindestens 2 Prozent Neigung in Richtung Fallrohr, um Wasserstau zu verhindern.
- Fallrohranschluss: Übergangsstutzen gewährleisten Wasserführung in senkrechte Fallrohre.
4.3 Anschluss an die Fassade
Speziell bei Putzfassaden ist ein Traufschlussprofil erforderlich, das die Fassade vor Spritzwasser schützt. Bei hinterlüfteten Fassaden werden einseitig gelochte Rinnenhalter verwendet, um die Luftzirkulation zu erhalten.
5. Wartung und Instandhaltung
- Regelmäßige Reinigung: Laub und Schmutz in Rinnen 2× pro Jahr entfernen.
- Dichtheitsprüfung: Muffen auf Undichtigkeiten prüfen, ggf. Silikonfugen erneuern.
- Korrosionsschutz: Metallrinnen alle 5–10 Jahre auf Rost prüfen und nachbehandeln.
- Fallrohrkontrolle: Ablauföffnungen freihalten und bei Bedarf mit Gitter sichern.
Ein gut gewartetes Traufsystem verlängert die Lebensdauer von Fassade und Dachabdichtung erheblich.
6. Innovative Lösungen und Trends
6.1 Integrierte Dachentwässerung
Moderne Flachdachsysteme integrieren Traufe und Regenrinne unsichtbar in Attikaplatten – ein ästhetisch ansprechender Ansatz, der Wartungsschächte für Fallleitungen verdeckt.
6.2 Smart-Gutter-Systeme
Sensorisch überwachte Rinnen erkennen Wasserstau und melden Verschmutzungen via IoT-Plattform an den Facility-Manager. Dies minimiert Wartungsaufwand und schützt vor Schäden.
7. Die Dachtraufe – mehr als eine schlichte Tropfkante
Die Dachtraufe ist weit mehr als eine schlichte Tropfkante: Sie verbindet Architektur, Hydraulik und Nachbarrecht in einem kleinen Bauteil mit großer Bedeutung. Eine fundierte Planung, normgerechte Ausführung und regelmäßige Wartung sichern langfristig die Bausubstanz und erhöhen Wohnkomfort wie Sicherheit. Dank moderner Innovationen wie integrierten Entwässerungslösungen und Smart-Gutter-Systemen bleibt die Traufe auch im 21. Jahrhundert ein zentrales Element nachhaltigen Bauens.
Quellen und weiterführende Links
In dem Videoclip „VLOG DieDachdeckerin | Folge 1 – Attika und Traufe“ erhält man Einblick in die Sanierung eines Flachdachbungalows, inklusive Arbeiten an Attika und Traufe.