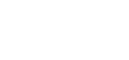Lied über die Walz, aus Franken
jetzo kommt die Zeit heran,
die Wanderszeit, die gibt uns Freud.
Woll´n uns auf die Fahrt begeben,
das ist unser schönstes Leben;
große Wasser, Berg und Tal
an zuschauen überall.An dem schönen Donaufluß
findet man ja seine Lust
und seine Freud auf grüner Heid,
wo die Vöglein lieblich singen
und die Hirschlein fröhlich springen;
dann kommt man an eine Stadt,
wo man gute Arbeit hat.
Mancher hinterm Ofen sitzt
und gar fein die Ohren spitzt,
kein Schritt vors Haus ist kommen aus.
Den soll man als G’sell erkennen,
oder gar ein‘ Meister nennen,
der noch nirgends ist gewest,
nur gesessen in sein’m Nest.
Mancher hat auf seiner Reis
ausgestanden Müh und Schweiß
und Not und Pein, das muß so sein,
trägt’s Felleisen auf dem Rücken,
trägt es über tausend Brücken,
bis er kommt nach Innsbruck ein,
wo man trinkt Tirolerwein.
Morgens wenn der Tag angeht
und die Sonn am Himmel steht
so herrlich rot wie Milch und Blut
auf ihr Brüder laßt uns reisen
unserm Herrgott Dank erweisen
für die fröhlich Wanderzeit
hier und in die Ewigkeit
 Der Verfasser des Liedtextes zu „Auf du junger Wandersmann“ ist unbekannt. Es entstand vermutlich um das Jahr 1840, in Franken. Unter anderem wurde das Stück in dem Liederbuch „Volker“ veröffentlicht. Die Liedersammlung stammt vom Verlag Eberhardt in Leipzig (Universitätsstrasse 18-20) und wurde bei Oscar Brandstätter in Leipzig gedruckt. Namensgebend für das Buch war eine Figur aus der bekannten Nibelungensage.
Der Verfasser des Liedtextes zu „Auf du junger Wandersmann“ ist unbekannt. Es entstand vermutlich um das Jahr 1840, in Franken. Unter anderem wurde das Stück in dem Liederbuch „Volker“ veröffentlicht. Die Liedersammlung stammt vom Verlag Eberhardt in Leipzig (Universitätsstrasse 18-20) und wurde bei Oscar Brandstätter in Leipzig gedruckt. Namensgebend für das Buch war eine Figur aus der bekannten Nibelungensage.
Zahlreiche Künstler haben den Titel im Laufe der Jahre und Jahrzehnte eingespielt, wie beispielsweise PitPauke
Eine frühere (und etwas längere) Form des Stückes trug noch den Namen
Auf, ihr Brüder, seid wohl daran!
Jetzo kommt die Wanderzeit heran
Ja, Wanderzeit, die gibt uns Freud
Auf die Reise wolln wir uns begeben
das ist unser schönstes Leben
große, große Wasser, über Berg und Tal
zu beschauen überallAn dem schönen Donaufluß
findet man ja seine Lust,
ja seine Freud
auf grüner Heid
wo die Vöglein lieblich singen,
und die Hirschlein fröhlich springen.
Dann kommt man vor eine Stadt,
wo man gute Arbeit hat.
Mancher, der hinterm Ofen sitzt,
zwischen den Fingern die Ohren spitzt,
keine Stund‘ fürs Haus
ist kommen aus:
Den soll man als Gesell erkennen,
oder gar als Meister nennen?
Der noch nirgens ist gewest,
stets gesessen in sein Nest.
Mancher, der wohl auf der Reis‘
ausgestanden Angst und Schweiß,
in Not und Pein,
das muß so sein:
Trägt sein Felleisen auf dem Rücken,
hat’s getragen über tausend Brücken;
dann kommt er nach Innsbruck ’nein,
da trinkt er Tirolerwein.
Wann der Sonntag kommt herbei,
daß wir Brüder beisammen sein:
Da geht dann
das Reden an
von den fremden Ländern, die man gesehen,
daß ein möcht‘ das Herz zergehen.
Das ist unsre größte Freud‘,
Burschen, die das Reisen freut.
Morgens wann der Tag angeht
und die Sonn‘ am Himmel steht,
so herrlich rot
wie Milch und Blut:
Auf, ihr Brüder, laßt uns reisen,
und den Herrn mit Danke preisen,
hier in dieser Wanderzeit
bis in unsre Ewigkeit.
Diese frühe Form des Lieds wandernder Handwerksgesellen stammt aus dem 18. Jahrhundert.
Wer das Lied selbst singen und gegebenenfalls spielen möchte, kann dazu zum Beispiel das Video „Auf du junger Wandersmann- Noten -karaoke“ vom YT-Kanal Music Man nutzen.
Populäres deutsches Volks- und Wanderlied mit Wurzeln im 19. Jahrhundert
„Auf, du junger Wandersmann“ ist ein populäres deutsches Volks- und Wanderlied, dessen Wurzeln bis ins 19. Jahrhundert zurückreichen und das heute noch fester Bestandteil vieler Maifestivals und Mundartfeste ist. Es entstand im Umfeld der fahrenden Handwerkergesellen („Burschenlieder“) und wurde mündlich tradiert, bevor es in Sammlungen wie Franz Wilhelm Dittfurths „Fränkische Volkslieder“ erstmals schriftlich niedergelegt wurde. Der Liedtext beschreibt die Sehnsucht nach Aufbruch und die Freude an Natur und Geselligkeit, während die Melodie durch eingängige Rhythmen und einfache Tonfolgen zum Mitsingen einlädt.
Historischer Kontext und Entstehung
Das Lied gehört zur Tradition der Wander- und Gesellenlieder, die im 19. Jahrhundert vorwiegend unter den Wandergesellen verbreitet waren. Diese Handwerker zogen nach Abschluss ihrer Lehre als Gesellen von Ort zu Ort, um Erfahrungen zu sammeln und die Sprache lokaler Dialekte kennenzulernen. „Auf, du junger Wandersmann“ fand erstmals um das Jahr 1855 Erwähnung in Ditfurths „Fränkischen Volksliedern II“und wurde später von Walter Hensel für das 1923 erschienene „Finkensteiner Liederbuch“ neu gefasst. Der Autor und der Komponist sind unbekannt, was typisch für mündlich überlieferte Volkslieder ist.
Text und lyrische Motive
Der Liedtext beginnt mit dem Aufruf „Auf, du junger Wandersmann, jetzo kommt die Zeit heran, die Wanderzeit, die gibt uns Freud‘!“ und vermittelt damit sofort die zentrale Thematik: die Sehnsucht nach freier Reise und Abenteuer. Die Strophen beschreiben das wirkliche „schönste Leben“ auf Wanderschaft – „große Wasser, Berg und Tal anzuschauen überall“. Die Naturbezüge (Donaufluss, grüne Heide, Vöglein und Hirschlein) unterstreichen die romantische Verklärung der Wanderzeit als Rückkehr zur Ursprünglichkeit. In späteren Strophen werden soziale Aspekte thematisiert: wer nicht wandert, bleibt „hinterm Ofen sitzen“ und wird nicht als Geselle, sondern allenfalls als Nesthocker wahrgenommen. Die allerletzte Strophe („Auf, ihr Brüder, laßt uns reisen, unserm Herrgott Dank erweisen…“) verbindet die Freude der Wanderung mit religiösem Danksagen.
Musikalische Merkmale und regionale Varianten
Die Melodie von „Auf, du junger Wandersmann“ ist harmonisch schlicht und zeichnet sich durch einen gleichmäßigen 4/4‑Takt aus, der zum gemeinsamen Singen einlädt. Die Tonart wechselt je nach Region und Bearbeiter; klassisch findet man sie in D-Dur oder G-Dur. Durch mündliche Überlieferung entstanden zahlreiche Variationen: In Franken wird sie etwas schneller gesungen, während in Süddeutschland ein gemäßigteres Tempo üblich ist. Notenausgaben mit Gitarrenakkorden und MIDI-Dateien sind heute frei verfügbar und unterstützen Musikinteressierte beim Erlernen.
Kulturelle Bedeutung und Wandel
Die Rolle in der Wanderbewegung
Im frühen 20. Jahrhundert fand das Lied Eingang in die Deutsche Wanderbewegung und wurde zu einem Standard im Repertoire von Jugendgruppen und Wandervereinen. Mit der Gründung des Wandervogels und später zahlreicher Touristikverbände wurde „Auf, du junger Wandersmann“ zum symbolischen Lied für Gemeinschaft und Naturerlebnis.
Volksmusik-Revival und moderne Interpretationen
Seit den 1970er Jahren erlebte das Lied dank Interpreten wie Heino ein Comeback auf Schallplatten und CD. Volksmusikgruppen arrangieren es neu mit Bläsern, Akkordeon und Gitarre, während Liedermacher moderne Textelemente ergänzen, um zeitgenössische Wandererlebnisse widerzuspiegeln. Zudem setzen Museen und Heimatvereine vermehrt auf Workshops, in denen das Lied und seine Geschichte vermittelt werden.
Pädagogische und soziale Aspekte
Sprachliche und musikalische Bildung
In Schulen und Musikschulen wird „Auf, du junger Wandersmann“ häufig als Beispiel für traditionelle Liedkultur verwendet. Durch das Singen lernen Schüler nicht nur musikalische Grundfertigkeiten, sondern auch historische Zusammenhänge und regionaltypische Dialekte.
Gemeinschaftsbildung und Identität
Das gemeinsame Singen dieses Liedes fördert den sozialen Zusammenhalt in Gruppen und Vereinen. Es dient im Vereinsleben als „Eisbrecher“ bei Festen und Ausflügen und stärkt das Gefühl, Teil einer kulturellen Tradition zu sein.
Quellen und weiterführende Literatur
-
Volksliederarchiv: Vollständiger Text und historische Anmerkungen zu „Auf, du junger Wandersmann“ Volksliederarchiv
-
Lieder-Archiv.de: Informationen zur Erstveröffentlichung in Dittfurths Sammlung und heutige Popularität Lieder-Archiv
-
Liederportal.de: Regionalinformationen zur Herkunft in Franken und Varianten liederportal.de
-
Liederlexikon.de: Überblick zu Walter Hensels Neufassung 1923 und Gattung „Burschenlied“ liederlexikon.de
-
Liederprojekt.org: Mitsingfassungen und Noten liederprojekt.org
Mehr als nur ein Wanderlied
„Auf, du junger Wandersmann“ ist mehr als nur ein Wanderlied – es ist ein lebendiges Zeugnis der deutschen Volkskultur, das Tradition und Moderne gleichermaßen verkörpert. Vom 19. Jahrhundert bis heute begeistert es Generationen mit seiner einfachen, aber prägnanten Melodie und den zeitlosen Themen von Freiheit, Natur und Gemeinschaft. Durch moderne Interpretationen, pädagogische Nutzungen und die digitale Verfügbarkeit bleibt es ein zentrales Element der kulturellen Identität und lädt weiterhin dazu ein, „große Wasser, Berg und Tal anzuschauen überall“.