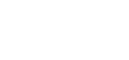Was kommt nach der Dachdeckerschule?
 Für frisch gebackene Dachdeckermeister ergeben sich verschiedene Möglichkeiten für den weiteren beruflichen Werdegang. Nach dem Besuch der Meisterschule und dem Erhalt vom Meisterbrief kann sich der Dachdeckermeister zum Beispiel selbstständig machen und ein eigenes Unternehmen aufbauen.
Für frisch gebackene Dachdeckermeister ergeben sich verschiedene Möglichkeiten für den weiteren beruflichen Werdegang. Nach dem Besuch der Meisterschule und dem Erhalt vom Meisterbrief kann sich der Dachdeckermeister zum Beispiel selbstständig machen und ein eigenes Unternehmen aufbauen.
Der Meistertitel ist in der BRD zwingend erforderlich, um sich mit seiner eigenen Dachdeckerei selbstständig zu machen, da es sich um einen zulassungspflichtigem Beruf mit einer sogenanntem Meisterpflicht (auch als Meisterzwang oder großer Befähigungsnachweis bezeichnet) handelt.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, sich von einer bestehenden Firma als Geschäftsführer einstellen zu lassen. Ein Studium mit entsprechender Fachrichtung ist nach dem Erhalt vom Meisterbrief ebenfalls möglich, zum Beispiel mit der Fachrichtung Bauingenieurwesen.
Dachdeckermeister – Was nun? Wege vom Meisterbrief in die berufliche Zukunft
Für viele Auszubildende und junge Gesellen markiert der Erwerb des Meisterbriefs einen Höhepunkt in ihrer beruflichen Laufbahn. Der Dachdeckermeister gilt nicht nur als handwerklicher Experte, sondern ist auch rechtlich befähigt, eigenverantwortlich einen Betrieb zu führen. Doch was kommt nach der Dachdeckerschule? Welche Perspektiven eröffnen sich, wenn man das Examen für den großen Befähigungsnachweis erfolgreich bestanden hat? In diesem ausführlichen Artikel beleuchten wir die vielfältigen Möglichkeiten, die sich einem frisch gebackenen Dachdeckermeister bieten – von Selbstständigkeit und Führungstätigkeit über akademische Weiterqualifikation bis hin zu Speziallaufbahnen in Industrie, Lehre und Verbandsarbeit.
Meisterpflicht und rechtlicher Rahmen
In Deutschland ist das Dachdeckerhandwerk ein zulassungspflichtiger Beruf, der unter die Regelungen der Handwerksordnung (§ 7 HwO) fällt. Diese sieht eine sogenannte Meisterpflicht oder auch großen Befähigungsnachweis vor: Nur wer den Meisterbrief besitzt, darf einen Dachdeckerbetrieb selbstständig führen und Lehrlinge ausbilden. Damit stellt der Meistertitel nicht nur eine Auszeichnung für handwerkliche Exzellenz dar, sondern ist zugleich eine zwingende Voraussetzung für die Unternehmensgründung. Die rechtlichen Grundlagen lassen sich auf der Website der Handwerkskammer und in der Wikipedia zu Handwerksordnung nachlesen.
Selbstständigkeit: Den eigenen Betrieb gründen
Nach dem erfolgreichen Abschluss der Meisterschule liegt die vielleicht naheliegendste Option darin, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Der Weg von der Erstellung des Geschäftsplans bis zum ersten Kundenauftrag umfasst zahlreiche Schritte: Standortwahl, Gewerbeanmeldung, Finanzierung, Beschaffung von Ausrüstung und Fahrzeugen, Personalrekrutierung und Marketing. Viele Dachdeckermeister setzen auf ein regionales Netzwerk, das sie bereits als Gesellen aufgebaut haben. Mit dem Meisterbrief in der Tasche genießt man bei Handwerksämtern, Banken und Versicherungen meist ein hohes Maß an Vertrauen – eine wichtige Voraussetzung für Kredite und Betriebsgenehmigungen.
Parallel zur Betriebsgründung zahlt sich eine solide kaufmännische Qualifikation aus. Die Meister-BAföG-Förderung ermöglicht im Vorfeld der Meisterschule bereits eine finanzielle Entlastung, doch für die erfolgreiche Führung des Betriebs sind Kenntnisse in Betriebswirtschaft, Rechnungswesen und Recht unerlässlich. Viele Kammern bieten ergänzende Kurse in diesen Bereichen an, die helfen, Liquidität, Personalplanung und rechtliche Vorgaben sicher zu managen.
Festanstellung und Geschäftsführung in etablierten Unternehmen
Nicht jeder Meister träumt von der Selbstständigkeit. Für viele ist die Übernahme von Führungsverantwortung in einem bestehenden Dachdeckerbetrieb attraktiver. In größeren Handwerksbetrieben oder Dachdecker- und Zimmerei-Kombinationen sucht man oft Meister als Geschäftsführer oder Betriebsleiter. In dieser Rolle steuert man Projekte, koordiniert Teams, verhandelt mit Auftraggebern und sorgt für die Einhaltung von Leistungs- und Qualitätsstandards. Wer hier seine Stärken vor allem im Zeit- und Ressourcenmanagement sieht, findet in dieser Position ein abwechslungsreiches Betätigungsfeld.
Akademische Weiterqualifizierung: Studium und Spezialisierung
Mit dem Meisterbrief in der Tasche steht dem Weg zu einem Bauingenieurstudium oder verwandten Studiengängen nichts im Wege. Universitäten und Fachhochschulen erkennen den Meistertitel oft als einschlägige berufliche Qualifikation an, sodass Studiengänge etwa im Bauingenieurwesen, in der Energie- und Gebäudetechnik oder in Wirtschaftsingenieurwesen offenstehen. Eine solche akademische Laufbahn ermöglicht den Einstieg in Planungsbüros, in die Forschung und Entwicklung von innovativen Baustoffen oder in die Projektleitung größerer Bauvorhaben. Zugleich öffnen sich Türen zu Positionen bei Architekturbüros, Baufirmen und kommunalen Bauämtern. Informationen zu Anerkennungsvoraussetzungen bietet das Portal Master-BaföG .
Aufbau einer Familiennachfolge und Betriebsübernahme
In vielen Regionen Deutschlands führen Dachdeckerbetriebe eine lange Familiengeschichte. Eine häufige Option für neue Meister ist daher die Übernahme eines elterlichen oder verwandtschaftlichen Betriebs. In diesem Fall steht man vor besonderen Herausforderungen: Man übernimmt bestehende Kundenbeziehungen, Mitarbeitende und gebäude- und projektspezifische Abläufe. Zugleich ergeben sich langfristige Sicherheiten durch bewährte Strukturen und einen renommierten Firmennamen. Betriebsübernahmen sollten mit einer sorgfältigen Due Diligence und einer klaren Nachfolgeregelung einhergehen.
Dozententätigkeit und Ausbilderrolle
Ein Dachdeckermeister kann sein Wissen auch an den Berufsschulen oder in den Meisterschulen weitergeben. Als Dozent in der Lehrlingsausbildung oder als Lehrgangsleiter für Meisterschüler prägt man die nächste Generation von Handwerkern. Diese Tätigkeit erfordert nicht nur fachliches Know-how, sondern auch didaktisches Geschick und die Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge verständlich zu vermitteln. Unabhängig davon, ob man bei der Handwerkskammer angestellt ist oder freiberuflich Seminare gibt, so bleibt man eng mit der handwerklichen Praxis verbunden und erhält Einblicke in neue Techniken und Materialien.
Produktentwicklung und Industrietätigkeit
Mit umfassender Praxiserfahrung und Meisterqualifikation haben Dachdeckermeister gute Voraussetzungen, um in Herstellerbetriebe oder Forschungsinstitute einzusteigen. Dort wirken sie bei der Entwicklung neuer Dachdeckungsmaterialien, bei der Verbesserung von Abdichtungsbahnen oder bei der Erforschung nachhaltiger Systeme wie begrünte Dächer und Photovoltaik-Integration mit. Industriepositionen als Technischer Fachberater oder in der Produktentwicklung bieten abwechslungsreiche Aufgaben und die Chance, Innovationen in die Branche zu tragen.
Beratung, Gutachter- und Sachverständigenwesen
Ein weiterer Karriereschritt kann das Gutachterwesen sein. Als öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für das Dachdeckerhandwerk prüft man Bauwerke auf Mängel, schätzt Schadensursachen ein und erstellt Gutachten vor Gericht. Diese Tätigkeit erfordert eine zusätzliche Qualifikation, etwa eine Zertifizierung durch die Innenordnung der Kammer oder der IHK, und bietet eine honorierte Nische abseits des operativen Alltags. Auch Positionen in Versicherungsgesellschaften als Schadensregulierer werden häufig von Dachdeckermeistern besetzt.
Spezialisierung auf energetische Sanierung und Nachhaltigkeit
Dank der steigenden Anforderungen an Energieeffizienz und Klimaschutz rückt das Thema energetische Dachsanierung immer stärker in den Fokus. Dachdeckermeister können sich zum Energieberater fortbilden und dabei helfen, Dächer nach KfW-Standard zu sanieren, Solarmodule zu integrieren oder Dämmkonzepte zu erstellen. Mit dem Fachwissen zur Passivhaus-Dachdämmung, aufgesattelten Gründächern und Smart-Gutter-Systemen nimmt man eine Schlüsselrolle in der Transformation des Gebäudebestands ein.
Internationaler Einsatz und Wanderschaft
Die Wanderschaft (Walz) war einst die Methode, internationale Kenntnisse zu sammeln. Heute kann man als Dachdeckermeister gezielte Auslandsprojekte anstreben. Ob beim Aufbau von Infrastruktur in Entwicklungsländern, im denkmalpflegerischen Einsatz in historischen Städten Europas oder in schnellen Neubauprogrammen weltweit – die Beherrschung moderner Techniken und der Meistertitel gelten international als Gütesiegel. Organisationen wie Aktion Deutschland Hilft oder unicef suchen gelegentlich Handwerksexpertise vor Ort. Auch Kommunikationsfähigkeiten in Fremdsprachen werden hier wertvoll.
Netzwerk und Verbandsaktivitäten
Ein Dachdeckermeister ist zugleich Teil einer lebendigen Zunftgemeinschaft. Durch aktive Mitgliedschaft in Fachverbänden und Innungen gestaltet man die Zukunft des Handwerks mit. Ob als Sprecher im Gesellenprüfungsausschuss, als Juror bei regionalen Wettbewerben oder als Referent auf Fachveranstaltungen – Engagement in Verbänden bietet Sichtbarkeit, Weiterbildung und Einfluss auf politische Entscheidungen, etwa in Sachen Handwerksförderung oder Ausbildungspolitik.
Persönliche Weiterentwicklung und Soft Skills
Mit dem Meistertitel sind fachliche Höchstleistungen nachgewiesen, doch um in Führungsrollen zu bestehen, benötigt man weitere Soft Skills. Seminare in Kommunikation, Konfliktmanagement, Teamführung und Digitalisierung sind heute ebenso gefragt wie betriebswirtschaftliche Kenntnisse in Controlling und Marketing. Wer als Dachdeckermeister ein Team motivieren, Kunden überzeugen und das Unternehmen langfristig strategisch ausrichten will, sollte diese Kompetenzen aktiv ausbauen.
Der Meister als Architekt seiner Zukunft
Der Dachdeckermeister steht an einem Scheideweg – mit zahllosen Wegen, die ihn in die Selbstständigkeit, in Führungsfunktionen, in die Wissenschaft oder in internationale Einsätze führen können. Jede dieser Routen erfordert Engagement, Netzwerkarbeit und oft eine weitere Qualifikation. Der große Befähigungsnachweis ist dabei nicht das Ende, sondern vielmehr der Startschuss für vielfältige Laufbahnen. Wer die Chancen nutzt, verantwortungsvolle Positionen übernimmt und sein Fachwissen stets weiterentwickelt, legt die Grundlage für eine erfolgreiche, zukunftssichere Karriere – weit über die Dachränder hinaus.
Handwerker, die sich Selbstständig machen möchten, erhalten dazu kostenfreie Hilfestellungen von den jeweils zuständigen Handwerkskammern. Informationen dazu erhält man zum Beispiel im dem Videoclip „Gründung im Handwerk“ von der Handwerkskammer Düsseldorf.